Der Kalte Krieg 1945 bis 1991
Neuer Kalter Krieg?

Mit dem Begriff „Kalter Krieg” wird die Epoche von 1945 bis 1991 bezeichnet, die von der machtpolitischen Rivalität zwischen den USA und der UdSSR sowie den jeweils mit ihnen verbündeten Staaten geprägt war. Die Spannungen zwischen den beiden Blöcken waren von grundlegenden Gegensätzen gekennzeichnet: Dem Kommunismus des Ostens standen die liberalen und kapitalistischen Demokratien des Westens gegenüber. Beide Staatenblöcke manifestierten sich in unterschiedlich ausgerichteten ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Systemen.
Die heute häufig vorgenommen Einteilung in ein westliches und östliches Europa ist eine Folge des sogenannten Ost-West-Konflikts, der die Weltpolitik im 20. Jahrhundert entscheidend prägte. Damit war nicht nur in Europa, sondern auch weltweit ein machtpolitischer Gegensatz verbunden, der die Welt mehrfach an den Rand eines atomaren Krieges brachte. Seit Jahren sind die Rivalitäten zwischen den USA und Russland wieder deutlich spürbar. Anstelle der damaligen bipolaren Weltordnung kristallisiert sich jedoch im 21. Jahrhundert mit der Großmacht China und Europa als weiterem Player eine neue, komplexere Weltordnung heraus.
Mit dem Konflikt um die Ukraine, der Krim-Krise 2014/15, dem erneuten Aufflammen des Konflikts 2021 und schließlich der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 haben die Spannungen zwischen Russland und dem Westen wieder stark zugenommen. Droht ein neuer Kalter Krieg? Befinden wir uns bereits darin? Oder könnte es gar infolge des Ukraine-Kriegs wieder zu einem großen Krieg kommen, bei dem sich die Großmächte der Welt abermals auf europäischem Boden gegenüberstehen?
Kalter Krieg
Definition
Unter dem Begriff „Kalter Krieg” versteht man einen Konflikt zwischen feindlichen Staaten, der nicht mit Waffengewalt ausgetragen wird (Die Waffen bleiben „kalt”, es wird nicht gekämpft) Der Konflikt findet vielmehr auf psychologischer Ebene statt. Mittels Propaganda, Drohungen und wechselseitiger Aufrüstung wird Macht demonstriert, um den Gegner abzuschrecken. So besteht immer die Gefahr, dass aus einem kalten Krieg ein „heißer“, ein echter Krieg werden kann.
Gemeinhin wird unter dem „Kalten Krieg” das Spannungsverhältnis bezeichnet, das nach Ende des Zweiten Weltkriegs zwischen den USA und der Sowjetunion bestand. Aber auch generell kann ein ohne Waffen ausgetragener Konflikt verfeindeter Staaten bzw. mehrerer Staaten, die jeweils verschiedenen Machtblöcken angehören, als „Kalter Krieg” bezeichnet werden.
Herausbildung zweier Blöcke

Der Konflikt zwischen Ost und West bildete sich im Sinne zweier sich in Blöcken gegenüberstehenden Großmächten in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg heraus. Nachdem die politischen Strukturen der Staaten Mitteleuropas zerschlagen worden waren, füllten die USA und die Sowjetunion das politische Vakuum und gestalteten es nach eigenen Vorstellungen und Interessen. Im Einklang mit der jeweiligen Ideologie wurden zwei Blöcke gebildet, die eigene politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und militärische Institutionen und Bündnisse ins Leben riefen. Der Begriff „Westen“ entwickelte sich zu einem Synonym für den Block liberaldemokratischer Staaten. Mit dem Terminus „Osten“ bzw. „Ostblock“ wurden die kommunistischen Staaten bezeichnet.
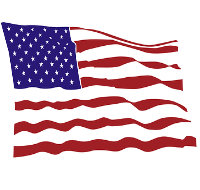
Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Blöcken nahm eine stark konfrontative Form an und ging als „Kalter Krieg“ in die Geschichte ein. Der Krieg gilt als „kalt“, da sich die Parteien zwar feindlich gegenüberstanden, kriegerische Mittel (Waffen) jedoch nicht zum Einsatz kamen. Allerdings gab es mehrere Krisen, die ein hohes Risiko für eine Eskalation bargen. Dazu gehören etwa die Blockade Berlins (1948/49), der Koreakrieg (1950–1953), der Vietnamkrieg (1946–1975), die Kubakrise (1962) oder der Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan (1979). Mit den Umbrüchen in den Ländern des östlichen Europas, die schließlich zu einem Zusammenbruch der sowjetischen Herrschaft führten und mit der Auflösung der Sowjetunion 1991 galt der Ost-West-Konflikt als beendet.
Folgen kommunistischer Herrschaft und Zusammenbruch
Jahrzehnte kommunistischer Propaganda und Erziehung sowie staatlich gelenkter Kultur- und Wirtschaftspolitik haben in den Staaten des ehemaligen Ostblocks tiefe Spuren hinterlassen. Diese Erfahrungen prägen das Denken und Handeln der Länder des östlichen Europas bis heute: sowohl in der politischen, wirtschaftlichen als auch gesellschaftlichen Entwicklung. Dabei war insbesondere auch die Phase der Transformation von Politik und Wirtschaft in den 1990er Jahren vom Gefühl großer Unsicherheit geprägt. Die Entwicklung des Wirtschaftssystems hin zur Marktwirtschaft bedeutete zunächst einen Rückgang der Produktion, einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und niedrigere Löhne. Jedoch schaffen sowohl die gemeinsame Erfahrung des Kommunismus als auch die darauf folgende Phase der Transformation eine enge Verbindung und Gemeinschaft zwischen den ehemaligen Staaten der Sowjetunion.
Zusammenbruch
Der Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft stellte die Staaten Osteuropas vor eine enorme Herausforderung. Innerhalb kürzester Zeit wollten sie ein demokratisches politisches System einführen und funktionsfähig machen. Gleichzeitig musste aber auch das Wirtschaftssystem reformiert werden. Eine funktionierende Marktwirtschaft war das Ziel. Für einige Staaten wurden diese Aufgaben dadurch erschwert, dass sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Unabhängigkeit erlangten und plötzlich ohne Unterstützung aus benachbarten Regionen auskommen mussten.
Die Gleichzeitigkeit der politischen und wirtschaftlichen Transformation stellte ein zentrales Problem des Wandels dar. Wirtschaftliche Reformen – etwa die Privatisierung der Unternehmen, die Einführung eines neuen Fiskalsystems oder die Liberalisierung des Handels und der Preise – führten zunächst zum Anstieg der Arbeitslosigkeit und zu einem massiven sozialen und materiellen Einbruch bei großen Teilen der Bevölkerung. Die vorhandenen Sozialsysteme waren dieser Belastung nicht gewachsen und brachen zusammen. In den Augen vieler Menschen waren diese Missstände eine Folge der Demokratisierung, die ja gleichzeitig stattfand. Eine Sehnsucht nach der Stabilität der sozialistischen Zeit breitete sich vielfach aus.
Demokratisierungen und Autokratisierungen
Den Weg aus dieser Krise meisterten die osteuropäischen Staaten auf unterschiedliche Weise. Manche von ihnen, z. B. die Staaten Ostmitteleuropas und einige südkaukasische Länder, hielten an der Demokratie und Marktwirtschaft fest und haben beachtliche Fortschritte erzielt. Im Nachhinein begrüßt die Mehrheit der Bevölkerung in diesen Staaten die Demokratisierung. Die Farbenrevolutionen in Georgien (2003) und in der Ukraine (2004) gelten als die wichtigsten Wendepunkte im Sinne der Demokratisierung im postsowjetischen Raum. Aber es gibt auch Staaten, die inzwischen wieder autokratisch regiert werden. Auch dort begrüßt die Mehrheit der Bevölkerung den eingeschlagenen Weg. In Weißrussland/Belarus ist das der Fall, aber auch in einigen anderen Staaten ist die Tendenz dazu vorhanden. Ob sie sich wieder in Richtung Demokratie entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Gerade in Belarus schlägt die Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung um. Nach den Präsidentschaftswahlen 2020 formten sich Massenproteste gegen Machthaber Lukaschenko und seinen autokratischen Regierungsstil. Auf den Spuren der Friedlichen Revolutionen 1989 versucht die Opposition, demokratische Werte einzufordern.
Weitere Informationen über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
Starke Ost-West-Unterschiede bis heute

Die unterschiedlichen Erfahrungshorizonte der Bevölkerung in Ost und West sind auch rund 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs deutlich spürbar. Zivilgesellschaft und Pluralismus, wichtige Bestandteile einer Demokratie, sind in vielen Ländern des östlichen Europas noch nicht ausreichend entwickelt. Die politische Partizipation ist vielfach schwächer ausgeprägt als in Westeuropa. Dies wird immer wieder an geringen Wahlbeteiligungen und niedrigen Mitgliederzahlen gesellschaftspolitischer Organisationen deutlich.
Die EU-Beitrittsperspektive bzw. der bereits vollzogene EU-Beitritt sowie die alternativen Partnerschaftsinitiativen haben in vielen Ländern eine mobilisierende sowie konsolidierende Wirkung erzielt. Da die meisten Länder eine Integration in die Europäische Union bzw. eine Annäherung an die EU anstreben, bemühen sie sich, die von der EU vorgegebenen Kriterien zu erfüllen. Wie die erste Runde der EU-Osterweiterung (2004) gezeigt hat, sind die ostmitteleuropäischen sowie die baltischen Staaten in ihrem Transformationsprozess am weitesten fortgeschritten. Erhebliche Schwierigkeiten lassen sich noch in den westlichen Balkanländern sowie in einigen Ländern der Östlichen Partnerschaft feststellen. Zudem bereiten populistische Tendenzen in Ländern wie Ungarn und Polen Beobachtern zunehmend Sorgen.
Umgestaltung der Weltordnung – Neuer Kalter Krieg?
Seit einigen Jahren ist die politische Weltordnung dabei, sich neu zu justieren. Herrschte in Zeiten des Kalten Krieges eine bipolare Weltordnung, prägt nun zunehmend das Machtdreieck China-USA-Russland die Welt. Europa sucht darin noch seine Rolle. Die internationale Staatenordnung ist in Bewegung, Unsicherheiten charakterisieren die Beziehungen zueinander, getrieben von technologischem Fortschritt, Sicherheitsgefahren, wirtschaftlichen Chancen und demografischen Verschiebungen. Noch ist nicht absehbar, welche neue Ordnung entstehen wird.
In den vergangenen Jahren zeigte sich in den USA der Trend, die Rolle als Vormacht des Westens nicht mehr einnehmen zu wollen, oder zumindest unter Präsident Trump anders auszuüben. Nach der Vorstellung des neuen US-Präsidenten Joe Biden soll Amerika nun wieder eine führende Rolle spielen. Dabei soll Chinas Machtbestreben zusammen mit der westlichen Allianz eingehegt und Autokraten wie Putin in die Schranken gewiesen werden.
Russland-USA-Beziehungen
„Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sind geprägt durch die nie vollständig überwundene Erbschaft des Kalten Krieges, die militärische Großmachtkonkurrenz, den Wettbewerb um regionale Einflusssphären, konträre politische Leitbilder und eine sich wechselseitig verstärkende Missachtung des Völkerrechts“, so Konfliktforscher Andreas Heinemann-Grüder.
So warf Russlands Präsident Wladimir Putin den USA auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Anfang 2021 vor, ein unipolares Weltmodell unter ihrer Herrschaft etablieren zu wollen. Dabei kritisierte er vor allem die Erweiterungspläne der NATO im Osten Europas. Nach Putins Ansicht war die Welt auch nach dem Ende des Kalten Kriegs zutiefst ungleich, nicht nur in Fragen der Osterweiterung der NATO, sondern auch in Bezug auf die westlichen Finanzhilfen in den 1990er Jahren, die viel zu klein gewesen wären, um Russland wirklich zu helfen. Die heutigen Konflikte hätten gewissermaßen vorab gelöst werden können, hätte es für Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einen eigenen Marshall-Plan gegeben, so Putin.
Aus Putins Sicht führt in den internationalen Beziehungen kein Weg mehr an Russland vorbei. So hat er die Einladung im Juni 2021 zu einem Treffen mit US-Präsident Biden gerne angenommen, um sich über zahlreiche wichtigen Themen der Weltpolitik auszutauschen und in einen strategischen Dialog zu treten. Neben dem Rüstungsabkommen sprachen die beiden Staatschefs über die derzeitigen Krisenherde. Beide hatten sich am Ende zufrieden über den begonnenen Dialog gezeigt. Zwar gebe es in vielen Fragen gegensätzliche Meinungen, doch hätten beide Seiten „den Wunsch gezeigt, einander zu verstehen und Möglichkeiten zur Annäherung ihrer Positionen zu suchen“. Biden sagte, „die zwei starken und stolzen Völker, die wir repräsentieren, müssen sehen, an welcher Stelle wir gemeinsame Interessen haben und zusammenarbeiten können. Meine Agenda ist nicht gegen Russland gerichtet, sondern auf die Durchsetzung der Interessen des amerikanischen Volkes.“
Mit dem im Februar 2022 begonnen Krieg Russlands gegen die Ukraine sind diese Versuche der Annäherung in weite Ferne gerückt. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind auf einem neuerlichen Tiefpunkt angelangt. Die Rede ist nun von einer neuen Ära des Kalten Krieges.
Auf dem NATO-Gipfel im Juni 2022 haben die Bündnisstaaten ein neues strategisches Konzept beschlossen, in dem Russland als die „größte Bedrohung" für Sicherheit und Frieden bezeichnet wird. In Folge des Krieges Russlands gegen die Ukraine befände sich die NATO in einer grundlegenden Umgestaltung und verfolge nun eine neue Strategie bezüglich ihrer Militärpräsenz an der Ostflanke. US-Präsident Biden erklärte: „Die USA tun genau das, was ich im Falle einer Invasion Putins angekündigt habe. Unsere Streitkräfte in Europa verstärken. Wir werden mehr Schiffe in Spanien stationieren, mehr Luftabwehr in Italien und Deutschland. Und wir errichten ein neues ständiges Hauptquartier in Polen.“
Und wenig später bei einem Staatsbesuch in Belarus sagte der russische Außenminister Lawrow: „Der eiserne Vorhang senkt sich.“
In seiner im September 2022 verabschiedeten neuen außenpolitische Doktrin wird das neuerliche Feindbild aus der Sicht Russlands deutlich. Als Gefahren für Russlands Sicherheit werden darin vor allem die USA und die NATO genannt. Ferner stellt er darin das Konzept einer „Russischen Welt“ vor, die es vor den Einflüssen des Westens zu schützen gilt. Putin betrachtet die ehemaligen Sowjetstaaten vom Baltikum bis nach Zentralasien als Teil der Einflusssphäre Russlands. Erst im Juli 2022 hatte Putin auch eine neue Militärdoktrin für die Kriegsmarine des Landes in Kraft gesetzt, in welcher Russlands Seegrenzen, darunter in der Arktis und im Schwarzen Meer, festgelegt wurden. Aufgebaut werden soll eine „ausreichende Zahl“ an Marinestützpunkten außerhalb der Grenzen Russlands. Die erstmals seit 2015 erneuerte Marinedoktrin ist somit auch eine Kampfansage an den Westen.
Werden sich die Feindseligkeiten abermals in einem neuen Kalten Krieg manifestieren? Oder könnte es womöglich wieder soweit kommen, dass sich die USA, ihre Verbündeten und Russland in einem großen Krieg auf europäischem Boden gegenüber stehen?
Weitere Informationen zum Ukraine-Konflikt und dem aktuellen Kriegsgeschehen
USA-China-Beziehungen
Was die Beziehungen zwischen den USA und China anbelangt, gebe es in Washington einen parteiübergreifenden Konsens darüber, dass dem strategischen Rivalen China künftig auch nicht mehr durch wirtschaftlichen Austausch geholfen werden darf, ökonomisch und technologisch aufzusteigen. Vielmehr soll mit allen Mitteln verhindert werden, dass China die USA in den technologischen Schlüsselbereichen überhole, so US-Experte Josef Braml. China habe sich in den vergangenen Jahren äußerst aktiv gezeigt, was diplomatische Initiativen und wirtschaftliche Investitionen angehe, um den Welthandel zu seinen Bedingungen neu zu ordnen. Die umfassende sogenannte Seidenstraßeninitiative („One Belt, One Road“) sei dafür nur das bekannteste Beispiel.
Russland-China-Beziehungen
Was die Russland-China-Beziehungen anbelangt, nähern sich beide Länder seit Jahren wirtschaftlich an und verfolgen gemeinsame Ziele, auch wenn die Beziehungen nicht spannungsfrei sind. Im Juli 2021 haben China und Russland ihren Nachbarschaftsvertrag verlängert. Dieser schreibt auch die gegenseitige Unterstützung der territorialen Integrität beider Staaten fest. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen spiele die russisch-chinesische Nachbarschaft eine „stabilisierende Rolle im Weltgeschehen“, betonte Putin. China wird von Russland unter anderem mit Öl, Gas und Kohle beliefert. Im Gegenzug verkaufen die Chinesen Maschinen und Konsumgüter nach Russland. Zudem verfolgen beide Länder ähnliche Interessen im UN-Sicherheitsrat und haben ein ähnlich angespanntes Verhältnis zu den USA. Im Zuge des aktuellen Ukraine-Krieges sind beide Länder noch näher zusammengerückt. Im März 2023 haben die beiden Staaten ihre strategische Partnerschaft mit neuen Abkommen bekräftigt. Zwei Vereinbarungen über die Partnerschaft und über die strategische Zusammenarbeit der Nachbarn bis 2030 seien unterzeichnet worden. Während der Westen Russland wegen des Krieges in der Ukraine zunehmend unter Druck setzt, festigen die beiden mächtigen Nachbarn ihre strategische Partnerschaft für eine „neue Weltordnung“.
Im April 2023 haben China und Russland einmal mehr ihre engen Beziehungen demonstriert. Bei einem Treffen der Verteidigungsminister Russlands und Chinas in Moskau haben sich Sergej Schoigu und Li Shangfu für eine intensivere militärische Zusammenarbeit ihrer Länder ausgesprochen. Über diese Kooperation auf der internationalen Bühne wollten die beiden Länder einen „stabilisierenden Einfluss” auf die Lage in der Welt zu nehmen, sagte Schoigu. Er setze auf die „engste und fruchtbarste Zusammenarbeit im Geiste der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen unseren Ländern, Völkern und auch zwischen den Streitkräften Russlands und Chinas". Russland strebe eine multipolare Weltordnung ohne eine „Vorherrschaft des Westens” unter Führung der USA an. Nach Angaben russischer Medien äußerte sich auch Li dahingehend, dass die militärtechnische Zusammenarbeit und die militärischen Handelsbeziehungen ausgeweitet werden sollen.
China und Russland aus Sicht der NATO größte Bedrohung
China und Russland stellen aus Sicht der NATO derzeit die größte Bedrohung für die Sicherheit im euro-atlantischen Raum dar. Beim NATO-Gipfeltreffen im Juni 2021 verabschiedete die NATO ihr Konzept „NATO 2030“. Darin stellt das Bündnis seine Zukunftsstrategie auf eine neue Grundlage und hat dabei besonders China im Blick. „Chinas erklärte Ambitionen und selbstbewusstes Verhalten stellen systemische Herausforderungen für die regelbasierte internationale Ordnung und relevante Bereiche der Sicherheit der Allianz dar“, heißt es in der Erklärung. Zudem wird darin kritisiert, dass China sein nukleares Waffenarsenal schnell erweitere, seine Truppen auf undurchsichtige Weise modernisiere und mit Russland militärisch zusammenarbeite. „China rückt näher an uns heran“, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Es liege auf der Hand, „dass China unsere Werte nicht teilt“.
Auf dem G7-Gipfel im April 2023 in Japan, sendeten die G7-Staaten eine klare Botschaft an Russland und China aus: Eine gewaltsame Änderung der internationalen Weltordnung sei nicht hinnehmbar. Man werde „der Welt die feste Entschlossenheit der G7 demonstrieren, die internationale Ordnung auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten", sagte der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi bei dem Treffen.
Weitere Informationen über die NATO und aktuelle Gipfeltreffen
China gehöre im Bereich Wissenschaft, Technik und Innovation bereits zu den führenden Nationen. „Unser Problem ist, dass dieses China wirklich modern, wirklich leistungsfähig ist und wir zugleich ein politisches System haben, das völlig unvereinbar mit unseren Ordnungs- und Wertvorstellungen ist“, so der Politologe Sebastian Heilmann. Die Kommunistische Partei Chinas fühle sich als Sieger der Geschichte und in ihrer Wahrnehmung sei es „unentrinnbar, dass China die USA in den kommenden zehn Jahren überholt“. Diesen Systemwettbewerb müssten wir ernst nehmen. Bei den Beziehungen zwischen vielen westlichen Staaten und China habe man derzeit eine „sehr ungute Entwicklung“ von „generalisierten Feindseligkeiten“ und „ganz verallgemeinertem Misstrauen“. Das habe mittlerweile „ein bisschen Kalter-Krieg-Atmosphäre“, so Heilmann.
Dokumentationen und Erklärfilme
Der Kalte Krieg einfach erklärt | Verklickern 17.02.2022 (3 min.)
Der Kalte Krieg erklärt | MrWissen2go Geschichte 14.03.2019 (12 min.)
Aufrüstung zur Abschreckung? Europas neue Fronten | ZDFzoom 03.04. 2022 (28 min.)
USA und China: Ein neuer kalter Krieg? | ARTE Mit offenen Karten 29.01. 2022 (12 min.)
Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa? | Deutsche Welle 2022 (42 min.)

Linksammlung
Quellen & weitere Infos
- BpB: Dossier: Der Kalte Krieg
- BpB: Kalter Krieg von 1945 bis 1989
- BpB: Das neue Spiel der Kräfte
- LeMO: Kalter Krieg
- MrWissen2go: Der Kalte Krieg erklärt
Lesen Sie weiter...
Kriege und Konflikte
Lesen Sie weiter....
Unsere Europa-Portale

Europa
Wissen und Unterrichtsmaterialien
Wie ist die EU aufgebaut? Welche Organe und Institutionen spielen eine tragende Rolle? Welche Länder gehören zur EU? Mit welchen Herausforderungen beschäftigt sich das europäische Bündnis derzeit? Und wo finden Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien zum Thema Europa? Unser Europa-Portal liefert Informationen und Materialien.

Osteuropa
Politische Landeskunde
Welche Staaten gehören zu Osteuropa? Was passierte nach der Auflösung der Vielvölkerstaaten Sowjetunion und Jugoslawien? Wo kommt es zu Konflikten? Welche Länder gehören inzwischen zur EU? Informationen über die Landeskunde sowie aktuelle politische Entwicklungen zu rund 25 Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa, Südosteuropa sowie den Staaten der Östlichen Partnerschaft.

Wahlen
Europawahl 2024
Wie funktioniert das europäische Wahlsystem? Welche Reformen stehen zur Debatte? Wer wird bei einer Europawahl überhaupt gewählt? Welche Parteien treten an mit welchen Wahlprogrammen? Wer liegt in Umfragen vorne? Unser Wahlportal liefert alle wichtigen Informationen zur Europawahl 2024.


